Nein, das hier wird kein Beitrag über die Geschlechterverhältnisse bei Menschen. Die Evolution hat nämlich auch ganz ohne uns Verhaltensweisen rund um die Fortpflanzung entwickelt, für die der Ausdruck „sexuelle Gewalt” sehr nahe liegt. Auch wenn dieser Begriff wohl weniger in die Biologie und eher in die Sozial- und Rechtswissenschaften gehört. Es geht mir hier aber nicht um Menschen und auch nicht um soziale oder kulturelle Geschlechteridentitäten (gender), sondern um das biologische Geschlecht (sex).
Dass ein evolutionärer Wettlauf zwischen Räuber und Beute oder zwischen Parasit und Wirtstier stattfinden kann, kennt man aus Dokumentarfilmen. (Ist aber immer wieder spannend.)
Biologen sagen dazu wohl „antagonistische Co-Evolution”.
Egoismus in der Paarbeziehung
Zwischen den Geschlechtern kann das anscheinend auch passieren: Das eine Geschlecht verschafft sich durch irgendwelche Tricks oder schlichte Grobheit höhere Fortpflanzungswahrscheinlichkeiten – auch wenn dies mit Nachteilen für das andere Geschlecht verbunden ist.
Das mag den Reproduktionserfolg aller verringern, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit für das betreffende Individuum, Nachkommen zu haben – die dann wiederum genau dieses Verhalten weiterführen und weitergeben.
Sexuelle Nötigung bei Wasserläufern
Wasserläufer-Weibchen der Art Gerris gracilicornis können sich durch eine Art Schutzschild vor ihren Genitalien vor erzwungenem Sex schützen. Die Männchen greifen jedoch zu anderen Zwangsmitteln: Sie besteigen die Weibchen und schlagen dann mit den Beinen auf die Wasseroberfläche. Die kleinen Wellen locken hungrige kleine Fische an. Die sind für das Weibchen viel gefährlicher als für das auf ihr sitzende Männchen. Je mutiger das Weibchen ist, desto höher ist ihr Risiko. Das steht in einem Beitrag, den Nature vor einiger Zeit veröffentlicht hat.
Wenn ich es richtig verstehe, folgt daraus doch wohl, dass nachgiebige Weibchen eher überleben. Der Wille zur weiblichen Selbstbehauptung steht hier dagegen gewissermaßen unter evolutionärem Druck.
Traumatische Insemination bei Wanzen und Würmern
Bei Bettwanzen führen die Männchen den Penis nicht in eine Körperöffnung des Weibchens ein, obwohl die vorhanden wäre. Sie durchbohren vielmehr dessen Bauchpanzer. Das nennt man „traumatische Insemination”.
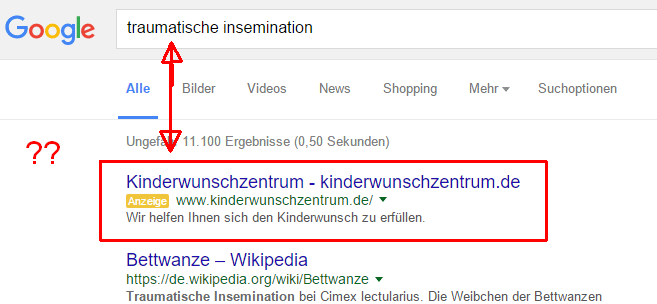
Der weibliche Bauchpanzer hat sich aber angepasst : Er führt den stachelartig verhärteten Wanzenpenis zu einem speziell geformten Organ (Spermalege), der von der Immunabwehr besonders gesichert wird. Übrigens gibt es sogar bei einigen Arten auch Spermalegen bei Wanzenmännchen, weil auch die von Geschlechtsgenossen traumatisch inseminiert werden.
(Nebenbei bemerkt: Wie faszinierend Wanzen und ihr Treiben auf Biologen wirken können, wird einem klar, wenn sie wie Prof. Klaus Reinhardt von der Uni Tübingen sogar literarische Werke über die Bettflundern herausgeben.)
Der Penis als Waffe
Ein anderes Beispiel für traumatische Insemination sind Samenkäfer, deren Männchen furchterregende Stacheln am Penis besitzen, die die Wände des weiblichen Genitaltrakts durchbohren und so zur Befruchtung führen. Der männliche Fortpflanzungserfolg ist um so größer, je länger die Penisstacheln sind, wie die Biologin Cosima Hotzy in ihrer Diplomarbeit gezeigt hat.

Ein weiteres Beispiel liefern Strudelwürmer. Diese Wasserbewohner sind Zwitter. Bei manchen von ihnen gehört zur Fortpflanzung zunächst ein heftiger Kampf mit dem Partner, für den die Wissenschaft den schönen Begriff des „Penisfechtens” gefunden hat: Jedes der Würmer versucht, den anderen durch traumatische Insemination mit einem seiner zwei Penisse (doppelt sticht besser) zu befruchten. Der Sieger kann sich anschließen gleich den nächsten Partner suchen. Der befruchtete Strudelwurm muss dagegen Zeit und Energie investieren, um die Eier heranreifen zu lassen.
Kindermord bei Säugetieren
Das Töten von jungem Nachwuchs durch Männchen der eigenen Art nennt man Infantizid. Er existiert bei vielen Säugetieren: bei Löwen, bei Bären und Delphinen, aber auch bei vielen Affen und Menschenaffen. Dieses Verhalten ist nicht etwa eine krankhafte Verhaltensstörung einzelner Tiere, sondern Teil des normalen Verhaltensspektrums. In einer großen Studie aus dem Jahr 2010 kam es bei 119 von 260 Arten vor, dass Männchen fremde Jungtiere töteten.
Infantizid tritt typischerweise bei Arten auf, bei denen
- die Weibchen saisonunabhängig fortpflanzungsfähig und außerdem tendenziell promiskuitiv sind, während
- die Männchen einen Harem für sich monopolisieren, aber ständig dessen Übernahme durch andere Männchen fürchten müssen.
(So jedenfalls z. B. bei Affen. Bei Bären ist es vielleicht etwas, aber nicht grundlegend anders.)
Wenn ein Männchen sich den Zugriff auf eine Gruppe von Weibchen neu gesichert hat und die noch von seinem Vorgänger gezeugten Jungtiere tötet, werden deren Mütter schneller wieder paarungsbereit. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Haremsbesitzer sich erfolgreich fortpflanzt – und den Hang zum Töten von Jungtieren an eine neue Generation weitergibt.
Geschlechtspartner oder Feind?
Evolution ist keine ethische Veranstaltung. Ihre Protagonisten treffen keine moralischen Entscheidungen. Sie unterliegen einfach einem simplen Muster: Verhaltensweisen, die die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Fortpflanzung erhöhen, werden gerade dadurch weitergegeben und breiten sich tendenziell aus. Das gilt auch dann, wenn das Plus an eigenem Fortpflanzungserfolg auf Kosten des daran beteiligten Partners geht.
Nein, ich will nicht sagen, dass man solche Erklärungen einfach auf menschliche Verhältnisse übertragen kann. Allerdings sollte man sie vielleicht im Kopf haben, wenn man menschliche Verhaltensweisen beobachtet. Schließlich sind wir ja nicht weniger Produkte der Entwicklung der Arten als Plattwürmer oder Bettwanzen. Wir haben uns nur ganz anders entwickelt.
Haben wir doch. Oder nicht?
Da drängen sich mir ein paar Fragen auf.Keine richtig wissenschaftlichen Fragen, fürchte ich. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie deshalb langweilig sind. Oder dass man gar nichts dazu sagen kann. Sondern nur, dass es vielleicht keine richtig wissenschaftlichen Antworten sein werden. Das mit den Geschlechtern scheint ja ein ziemliches Erfolgsmodell zu sein. Ich glaube, das Muster geht in etwa so: eine Art zerfällt in zwei Gruppen, deren VertreterInnen sich nur jeweils mit einem Modell der anderen Sorte fortpflanzen können. Beide leisten dabei einen unterschiedlichen Beitrag zum gemeinsamen Projekt. Wie der Beitrag ausfällt, ob Väter etwa fürsorglich sind oder das Gegenteil davon, ist von Art zu Art aber unterschiedlich. Nur eben anders als der der Mutter.
|
Antworten von Prof. Klaus Reinhardt
Vorweg: Der Pfad von der biologischen zur sozialwissenschaftlichen Terminologie ist tatsächlich oft ein sehr schmaler Grat, nicht nur bei Themen wie Gender oder Homosexualität, auch bei Gewalt.
- Was ist der Vorteil, dass es zwei Versionen einer Art gibt, Männchen und Weibchen?
Da sich beide Versionen vermischen, ist das im Prinzip die Frage: Welchen Vorteil hat Sex beziehungsweise sexuelle Rekombination? Dazu gibt es viele Ideen. Die wichtigeren beziehen sich darauf, dass so Parasitenbefall vermieden oder reduziert oder der Alterung des Genoms entgegengewirkt werden kann. „Evolution of sex“ ist ein sehr langes Kapitel. Das lässt sich nicht in ein paar Worten abhandeln. Auf spezielle Fragen dazu kann ich aber gerne noch spezielle Antworten geben. - Warum gibt es höchstens zwei?
Die Reproduktion mit zwei Geschlechtern scheint eine Lösung zu sein, auf die das System immer wieder zurückfällt, eine „evolutionär stabile Strategie“, wie sie beispielsweise Geoff Parker 1990 in seinem Beitrag über Spermienwettbewerb darstellt. Nehmen wir einmal an, es gäbe drei unterschiedliche Geschlechter. Dann würden sich deren Keimzellen unterscheiden, auch in Bezug auf die Größe. Die Größe ist aber entscheidend für Beweglichkeit und Lebensdauer dieser Zellen – und das führt langfristig dazu, dass die meisten Nachkommen entstehen, wenn die kleinsten und schnellsten Keimzellen gegen die langlebigsten, größten Zellen stoßen – weil aus dieser Kombination rasch langlebige Nachkommen entstehen. Die Kombination klein & klein lebt kurz, groß & groß ist zu schwerfällig – klein & mittel oder groß & mittel sind demgegenüber zwar etwas besser, aber die besten Chancen hat eben die Kombination aus Beweglichkeit und Lebensdauer: klein & groß.
Das mittlere Geschlecht würde sich gegen klein und groß also nicht durchsetzen.
Und so ist es ja auch: die kleinen Zellen nennen wir Spermien und ihre Träger Männchen. Die große Zellen sind die Eizellen der Weibchen. Etwas Geheimnisvolleres steckt nicht dahinter. - Gehört der Wettlauf automatisch zum Geschlechtermodell dazu?
Nein, nur dann, wenn sich das Weibchen mit mehr als einem Männchen paart. Dann nämlich kann der Reproduktionsvorteil, den ein Männchen gegenüber anderen Männchen manchmal für sich erzielt, wenn er dem Weibchen Schaden zufügt, den direkten Nachteil für das Weibchen und damit den indirekten Nachteil für sich selbst mehr als wettmachen.
Sind Männchen und Weibchen monogam, dann ist die Fitness der beiden identisch – und dann profitiert das Männchen von direkter oder versehentlicher Schädigung nicht. - Was bedeutet das für uns Menschen?
Für uns Menschen bedeutet das zumindest, dass es biologische Geschlechterunterschiede gibt, die nicht ausschließlich sozial erklärt werden können, wie das ein Teil der Genderforschung behauptet.
Und das wiederum bedeutet, dass etwa Medikamente bei Frauen und Männer nicht gleich wirken müssen – eine Erkenntnis, die sich ja wohl auch in erste Anstrengungen niederschlägt, dem gerecht zu werden.
Übrigens scheinen männliche Vertreter sowohl in der Mäuseforschung wie in klinischen Studien an Menschen extrem überrepräsentiert zu sein. Ob das nun wiederum ein Ausdruck von sex oder gender ist, vermag ich nicht zu sagen. Sowohl der Aufenthalt im Gefängnis – (eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Quelle von Probanden) wie auch das Merkmal erhöhter Risikobereitschaft sind bekanntlich männchenlastig.
Über die Auswirkungen solcher Geschlechterunterschiede auf psychologische Konflikte zwischen Männern und Frauen möchte ich nun wirklich nicht spekulieren, da kenne ich mich nur laienhaft aus.
Eine sehr interessante Implikation beispielsweise der Fortpflanzung bei Wanzen für Menschen scheint mir dagegen, dass evolutionäre Konflikte nicht nur durch Vermeidung oder durch Gegenwehr (Resistenz) gelöst werden können, sondern auch durch Aushalten (Toleranz). Vielleicht lassen sich auf Basis dieses Gedankenmodell auch Konfliktmodelle für andere Bereiche entwickeln – Modelle, die aussagen, wann Resistenz und wann Toleranz jeweils besser ist. Wann braucht man schärfere Gesetze, und wann sollte man eher lernen, ein Auge zuzudrücken?
Klaus Reinhardt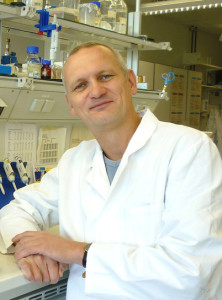 … ist Professor für Angewandte Zoologie an der TU Dresden und hat sich in seiner Habilitation mit der traumatischen Insemination bei Bettwanzen auseinandergesetzt – was freilich nur einer seiner vielen Interessens- und Themenschwerpunkte ist. Mitunter verlässt er auch den Elfenbeinturm der Forschungslaboratorien: Etwa mit der von ihm herausgegebenen Anthologie „Literarische Wanzen“ (Leseprobe gefällig?) oder wenn er sich unter dem Titel Paria Creation dem multimedialen Auftauchen aus der Wissenschaft widmet. |